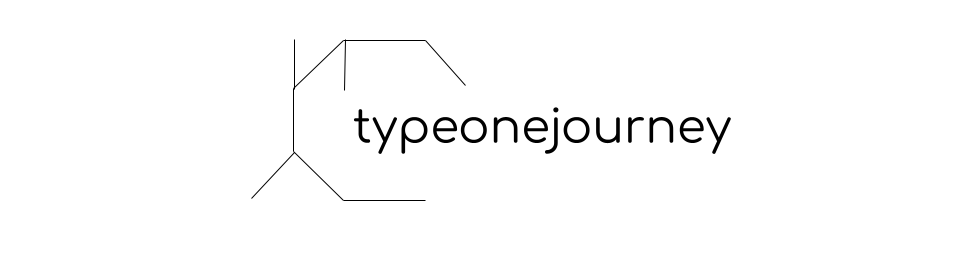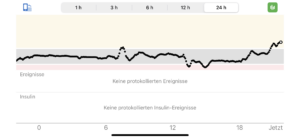Nach der Diagnose mit Diabetes war meine Zeit im Krankenhaus für mich eine kuriose Erfahrung. Es ist eine seltsame Welt, in der rohe Paprika ein Highlight ist und amputierte Gliedmaßen die Norm.
Diabetes hat mich direkt als wir uns kennengelernt haben direkt ins Krankenhaus gebracht. Ja leider habe ich nicht früh genug auf meinen Körper gehört. Mit meiner Erstdiagnose Typ-1-Diabetes durfte ich nicht über Los gehen, sondern bin ohne Zwischenstopp direkt in die Klinik. Meine ersten Symptome beschreibe ich in einem anderen Blogbeitrag. Tatsächlich war diese Zeit im Krankenhaus tatsächlich äußerst Lehrreich, irgendwie auch entspannt und in jedem Fall ein Kuriositäten-Kabinett. Aber der Reihe nach.
1. Die Ankunft
„Fühlen Sie sich in der Lage Taxi zu fahren?“, fragt mich die Assistentin in der Diabetologie. „Ja danke“, sage ich leicht verwirrt, „ich bin mit dem Fahrrad hier.“ Gerade wure festgestellt, dass ich alarmierend hohe Ketonwerte und einen Blutzuckerwert von über 240 habe. Ich stelle also mein Rad vorsichtshalber, in den Hinterhof meiner Arztpraxis und warte auf mein Taxi. So komme ich in die Notaufnahme. Ich habe richtig Schiss. Klar, ich weiß jetzt immerhin, dass ich Diabetes habe, aber es ist ein Krankenhaus. Allein das Gruselt mich. Das letzte Mal war ich im zarten Alter von zwölf Jahren in einem, weil ich mir in Frankreich den Arm gebrochen habe. Und jetzt auch noch eine Berliner Notaufnahme. Mein Kopfkino gibt Vollgas: Ich stelle mir Kinder mit Dartpfeilen im Auge vor und Menschen, die mit Atemmaske im Vollsprint hinter Türen verschwinden – immerhin ist ja noch Pandemie!
Die Wahrheit ist ernüchternd. Ich setze mich kurz in ein Wartezimmer in der Notaufnahme. Dann werde ich abgeholt und komme auf eine Liege in einem kleinen Separee. Corona-Test, Blutabnahme, EKG – in 10 Minuten wird meine Basisgesundheit festgestellt. Ein kleiner dicker Mann mit viel Sinn für Humor kommt herein. Das ist also mein Notfall-Arzt. „Na junger Mann, Vorerkrankungen in der Familie?“, fragt er. „Ja mein Vater war auch Typ-1-Diabetiker“, antworte ich unsicher. Ohne eine Sekunde zu zögern haut der gute Mediziner raus: „Tja, da wissen Sie ja womit Sie es zu tun haben.“
Während der kugelige Mann mit dem Computer kämpft, um meine Krankenakte zu bearbeiten, läuft mir auch schon die erste Kochsalzlösung in die Venen. „Wohin muss ich wohl spenden, damit dieses Krankenhaus eine moderne IT-Ausstattung bekommt?“, frage ich mich und versuche mich zu entspannen. In der Notaufnahme ist es ruhig. Nur ein anderer Patient ist in Hörweite, und kämpft offenbar um Luft. Ein Liter Kochsalzlösung später werde ich aus der Notaufnahme entlassen. Kanüle im Arm gehe ich immerhin auf den eigenen Beinen auf die Diabetes Station.
2. Die erste Dosis Insulin
„Darf ich jetzt bald was essen?“ Das ist meine erste Frage an meine zuständige Ärztin, nach der Anamnese. Ich bin nüchtern geblieben, weil ich dachte, dass das vielleicht wichtig wäre für irgendwelche Tests. Immerhin waren durch mein Fasten, mein Blutzuckerwerte so nur furchtbar und nicht katastrophal. Tatsächlich wird mir Mittagessen besorgt und ich bekomme meine erste Dosis Insulin – und bei mir setzt die Erleichterung ein.
Zur Erinnerung: Mir war seit drei Tagen schlecht, ich konnte schlecht gucken, habe fünf Kilogramm Gewicht verloren und nachts haben mich Krämpfe in den Beinen nicht schlafen lassen. Jetzt hat das endlich ein Ende. Die erste Dosis Insulin löst fast Euphorie aus.
Dann lerne ich auch meinen Zimmernachbarn kennen. Er wird im Bett hereingerollert. Auftritt: Ottmar. Ottmar ist Fleischer, wiegt vom Aussehen zu urteilen rund 150 Kilogramm. Jetzt nach der OP vielleicht nur noch 149 Kilo. Ihm wurden gerade vier Zehen amputiert. Dennoch ist Ottmar ein feiner Kerl und guter Mitbewohner. Gegen das Sägewerk in seinem Mund-Nasen-Bereich helfen zum Glück Ohropax. Trotz Corona kommt seine Familie ab und an zu Besuch. Dann erklärt Ottmar seiner Familie: „So jetzt ändere ich aber was. Jetzt, wo die anderen Zehen auch ab sind. Jetzt muss ich mal was machen.“ Eifrig stimmen sie zu. Gemeinsam wollen sie ihre Ernährung umstellen. Zwei Tage später schmuggeln sie Ottmar aus dem Krankenhaus um einen Burger zu essen. Der Mann hat vier Zehen verloren – das Festmahl sei ihm gegönnt.
3. Ungeahnte Nebenwirkungen
Und plötzlich kann ich sehen. Ich setze die Brille auf. Ich setze sie wieder ab. Ich schaue noch mal ohne Brille in Richtung Fenster. Ultra-HD. Ich sehe jede Ziegel auf dem Dach des Nachbargebäudes. Meine Brille brauche ich nicht mehr. Meine Haut wird schlagartig besser. Vorher noch von Rosacea (roter Hautausschlag im Gesicht) geschlagen, habe ich Haut wie vor der Pubertät. Kopfschuppen, eine Geißel seit ich 13 bin, sind plötzlich verschwunden.
Überhaupt fühle ich mich insgesamt fantastisch. Kennt ihr das Gefühl, wenn die Kopfschmerztablette wirkt, und der Kopf aufhört zu wummern – so fühlt es sich an. Nur am ganzen Körper. Zwar komme ich noch ins Keuchen, wenn ich Treppen steige, aber ansonsten fühle ich mich fit und besser als die letzten vier Monate. Dafür fallen mir andere Dinge auf: Oh wenn mein Zucker zu hoch steigt, werde fühle ich mich hyperaktiv. Fröhlich, frisch, verliebt. Die Ohren kribbeln ein wenig. Ein ganz neuer Erfahrungshorizont tut sich auf. Was könnte Diabetes noch alles für (positive und negative) Nebenwirkungen haben? Ein neues Kapitel meines Lebens tut sich auf. Aber das wichtigste ist natürlich im Krankenhaus:
4. Das Essen
Meine erste Mahlzeit mit Diabetes im Krankenhaus war: Eierfrikasse. Meine Frau sagt noch heute, es sei das schlimmste Essen, was sie je gesehen habe. Für mich war es ein Festmahl. Ausgehungert und endlich mit Insulin im Blut war es mir eine Freude die gräuliche Masse aus Kartoffeln und Eiern gespickt mit ein paar grünen Erbsen zu vertilgen.
Auch den restlichen Aufenthalt sind die Mahlzeiten erstaunlich gut. Eine herzensgute aber strenge Dame kommt drei Mal am Tag mit einem Wägelchen vorbei, und ich kann mir meine Mahlzeiten sogar aussuchen und selbst zusammenstellen. Das Beste: Ich kann auch mal eine Scheibe Brot mehr bekommen oder eine kleine Extraportion Nudeln. Immerhin habe ich vier Kiloabgenommen und mein Körper freut sich über jede Kalorie. Nur laufe ich am Anfang immer mit einer handlichen Waage herum. Jede Kartoffel, jede Nudel und jede Scheibe Brot wiege ich ab. Meine größte Angst ist, mich beim Insulin zu verkalkulieren. Aber dank Merkzettel und ein bisschen Übung habe ich schnell den Bogen raus.
Die einzige Krux: Die Rohkost. Der Stationsflur ist wie ein „U“ aufgebaut. Jeden Tag startet das Essenswägelchen im Wechsel auf der jeweils anderen Seite. Da mein Zimmer am Ende des „U“ liegt, muss ich jeden zweiten Tag hoffen. Mit etwas Glück bekomme ich zu meinem Essen dann noch etwas Frisches; eine Gurkenscheibe oder ein paar Stückchen Paprika. Jeden zweiten Tag fürchte ich um meine Vitaminzufuhr.
5. Die erste Spritze
Na klar, ich lerne im Krankenhaus auch unheimlich viel über meine neue Krankheit. Ab sofort begleitet mich Typ-1-Diabetes. Die Tests vom ersten Tag lassen daran keinen Zweifel. Tagtäglich übernehme ich jetzt die Aufgaben von meiner faulen Bauchspeicheldrüse und spritze mir das Insulin halt selbst, wenn das Organ das nicht will. Und dafür muss ich sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich erfahre viel über Kohlenhydrate, Insulin, Unterzucker und all die Dinge, die ich jetzt beachten muss. Auch muss ich die Kohlenhydrat-Menge von bestimmten Mahlzeiten einschätzen. Bei den Spätzle in Linsen klappt es schon sehr gut (wer ist sowas?). Und natürlich: Ich muss mir selbst Insulin verabreichen.
Die erste Spritze ist ein äußerst komisches Gefühl. Ich habe die Schwester am ersten Tag genau beobachten, als sie mir mit dieser winzigen Nadel insulin verabreichte. Jetzt bin ich selbst dran. So viel ist klar: Es ist super komisch, sich selbst „zu verletzen“, und sich ein spitzes Etwas in die Haut zu setzen. Andererseits habe ich schon tausendfach mit Stecknadeln herumgespielt und sie mir aus Versehen in die Finger gebohrt. Wie schlimm kann es also sein. Ich nehme also meinen Mut zusammen, mache es der Krankenschwester nach – und ich wundere mich, dass ich gar nichts gemerkt habe. Es ist wirklich ein Wunder der Technik, dass man so winzig schmale Nadeln produzieren kann. Heute weiß ich natürlich, dass die Nadeln auch zwicken und zwiebeln können, wenn ich eine blöde Stelle erwische. Zum Glück war die erste Nadel harmlos.
Fazit: Keine Angst vor Diabetes im Krankenhaus
Für mich persönlich war die Zeit mit Diabetes im Krankenhaus eine spannende Erfahrung. Natürlich hatte ich auch Angst. Angst, was jetzt auf mich zukommt mit der Krankheit. Angst, mich beim Insulin zu verrechnen und Angst, mein Leben komplett verändern zu müssen. Aber insgesamt war die Zeit im Krankenhaus gut, um mir darüber klar zu werden, was mein neuer Begleiter für mich bedeutet. Ich konnte mich in das Thema einlesen, mich mit Ottmar über die Krankheit austauschen, und meine Diabetesberaterin hat mich bestens betreut. Also keine Angst vorm Krankenhaus – manchmal kann dies genau die richtige Umgebung sein, für den Startpunkt in ein neues Kapitel im Leben.
Wie war das bei dir?
Hat dich dein Diabetes auch direkt ins Krankenhaus befördert? Oder wurdest du vielleicht ambulant behandelt? Ich freue mich auf deinen Kommentar oder schreibe mir auf Instagram!